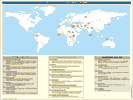Die strategische Lage zum Jahreswechsel
von Lothar Rühl
Kurzfassung
◄ Wie in den Jahren zuvor bestimmten die Kriegsherde Afghanistan, Irak und Naher Osten das internationale Geschehen 2006. Dazu gesellte sich Nordkorea, das den anerkannten Status eines Kernwaffenstaates, eine amerikanische Sicherheitsgarantie und eine direkte bilaterale Beziehung zu den USA als Aufwertung seiner internationalen Position anstrebt. Der Besitz von nuklearen Waffen würde Pjöngjang zur Ausübung von militärischer Dominanz gegenüber dem reichen und von den USA abgeschirmten Südkorea verhelfen sowie als Druckmittel gegenüber seinen Nachbarn im Süden und Osten dienen.
Ebenso zeigt auch der noch nicht vollendete, wiewohl wahrscheinliche Proliferationsfall Teheran, dass es für die Nichtweiterverbreitung nuklearer Waffen letztlich auf die Vertragsdurchsetzung, d.h. notfalls auf internationale Gewaltanwendung als letztes Mittel nach Sanktionen ankommt. Allerdings wollten weder China noch Russland diese Zwangsmittel zur Anwendung gegen Nordkorea oder den Iran kommen lassen. Damit waren die internationale Sicherheits- und Ordnungspolitik in beiden Fällen blockiert sowie die USA und UNO politisch ausmanövriert.
Im Jahr 2006 bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen über die längerfristigen Folgen des amerikanisch-britischen Interventionskrieges im Irak. Die seit dem Sommer 2003 eskalierende Krise der amerikanischen Besatzungspolitik mit militärischen Operationen gegen einen kaum fassbaren Feind erreichte im Jahre 2006 einen neuen Höhepunkt und erfasste den gesamten Irak. Die USA verloren sowohl die strategische Flexibilität als auch die Initiative; damit drohte der amerikanischen Machtpolitik nicht nur am Golf, sondern im gesamten Orient die Lähmung.
Ebenso war das Jahr 2006 am Hindukusch keine gute Zeit für den Westen. Zwar fügten Briten, Kanadier und Niederländer, die von den Amerikanern den Süden Afghanistans mit seinen fünf unruhigen Provinzen übernommen hatten, den Taliban schwere Verluste zu, konnten aber das Eindringen neuer Kämpfer aus dem paschtunischen Grenzgebiet Pakistans nicht verhindern und sahen sich demselben unveränderten Problem gegenüber, das schon die Amerikaner nicht hatten meistern können: Die NATO-Truppenstärke in der ISAF reichte nicht aus. Die Ausdehnung der NATO-Verantwortung für die Sicherheit auf ganz Afghanistan treibt das militärische Engagement der Verbündeten immer weiter und immer tiefer in ein Land, das niemals geeint oder befriedet war und das im Westen wie im Osten zwischen Nachbarn liegt, die von außen beherrschenden Einfluss gewinnen wollen: Iran und Pakistan.
Die katastrophale Lage im Palästinensergebiet von Gaza, die Kalamitäten im Westuferland des Jordan, wo Palästina mit dem Annex Gaza als unabhängiger Staat entstehen soll, der gewalttätige Streit zwischen den rivalisierenden radikalen Organisationen Fatah und Hamas um die Macht seit den israelischen Wahlen hängen mit der Entwicklung im Libanon hin zum Hisbollah-Krieg Israels zusammen. Dieser Konnex ist nicht augenfällig, aber das Bindeglied in Damaskus verdeutlicht ihn in der syrischen Konfliktstrategie gegen Israel für eine Zweifrontenkriegslage indirekter Aggression ohne militärische Beteiligung Syriens mit dem Ziel, den von Israel annektierten Golan zurückzugewinnen.
Für Amerika als führende Weltmacht, als externe Vormacht im Mittleren Osten und im Fernen Osten, als Führer der westlichen Bündnisse und potenten Garanten des internationalen nuklearpolitischen Sicherheitsregimes sind die verschärften Krisen zu einer kritischen weltpolitischen und globalstrategischen Herausforderung geworden, der Washington bisher keine kohärente Strategie entgegenzusetzen vermochte. ►
Volltextversion
Die strategische Lage zum Jahreswechsel
Wie in den vergangenen Jahren bestimmten die Kriegsherde Palästina, Afghanistan und Irak das internationale Geschehen im Jahre 2006. Die Brennpunkte der nuklearen Proliferation, Iran und Nordkorea, blieben bestehen; der Letztere und ältere leuchtete am 9. Oktober auf, als Pjöngjang bekannt geben ließ, dass ein Kernwaffenversuch stattgefunden habe - kurz nachdem die Regierungschefs Chinas und Japans in Peking in einem gemeinsamen Kommuniqué erklärt hatten, dass ein solcher Versuch "nicht akzeptabel" wäre. Die Provokation durch den nordkoreanischen Nachbarn beider Mächte war demonstrativ, wie auch gegenüber den USA und Russland, von Südkorea nicht zu sprechen. Auch wenn es sich bei dem Versuch noch nicht um eine Kernwaffe, sondern eher um eine kleine Kernsprengladung handelte (der russische Verteidigungsminister Sergej Iwanow sprach von 5 bis 10 Kt), aus der nach weiteren Versuchen erst noch eine einsatzfähige Waffe entwickelt werden müsste, war der lange angekündigte Schritt über die Atomwaffenschwelle getan und die Aussicht auf mehrere Kernwaffen in Nordkorea in den kommenden Jahren geöffnet; in Verbindung mit dem Bau von Mittel- und Langstreckenraketen eine bedrohliche Perspektive nicht nur für Japan, sondern auch für Nordamerika und Taiwan, von dem unmittelbar über kürzeste Entfernung durch nukleare Artillerie massiv angreifbaren und deshalb politisch leicht erpressbaren Südkorea ganz abgesehen. Damit waren die ohnehin wegen der Verweigerung Pjöngjangs seit einem Jahr unterbrochenen "Sechs-Mächte-Gespräche" über eine politische Regelung des Streits ihrer Geschäftsgrundlage verlustig gegangen. Die weiteren Folgen waren unabsehbar, wiewohl die Beispielwirkung auf andere Länder an der nuklearen Rüstungsschwelle, allen voran Iran und Japan, vorstellbar ist und im Bereich der Möglichkeiten liegt wie auch eine Steigerung der Unsicherheit über die weitere nukleare Politik Indiens und Pakistans mit Raketen.
Von besonderer Bedeutung ist dabei, wie früher im Falle Pakistans, das Risiko einer Weitergabe von nuklearem Material für Sprengladungen und von Waffentechnologie durch Nordkorea an andere Länder und an nichtstaatliche Akteure, d.h. an internationale Terroristen oder Mafiaorganisationen gegen Geld. Solche Kaufkraft ist als Gewinn aus dem weltweiten Drogenhandel in großem Umfang vorhanden und entsteht in jeder Mohn- und Kokaernte neu.
Internationale Kriminalität und Terrorismus sind längst Geschäftsverbindungen in Südamerika und im Orient eingegangen, wie der Fall des Pakistaners Qadeer Khan im Verhältnis zu Iran und zu Nordkorea gezeigt hat.
Pjöngjang hat seinerseits seit Jahrzehnten Raketen in den Nahen und Mittleren Osten verkauft. Zwar scheint es im Jahre 2006 noch weit von nuklearen Raketengefechtsköpfen entfernt, doch die kommunistische Diktatur in Pjöngjang unter dem exzentrischen Führer Kim Jong Il hat seit Beginn der 1990er-Jahre systematisch und beharrlich an ihrem Atomprogramm auf der Basis ex-sowjetrussischer Schwerwasserreaktoren, die waffenfähiges Plutonium produzieren können, und eigener Uranerzvorkommen gearbeitet. Der wirkliche Stand der Entwicklung kann heute von außen und ohne regelmäßige Kontrolle des Kernbrennstoffflusses samt allen technischen Anlagen nicht wirklich eingeschätzt werden. Darum drehte sich der Streit Pjöngjangs mit der IAEA und den USA. Aus dem NPT ist Nordkorea ausgetreten, also völkerrechtlich nicht länger an den Verzicht auf Kernwaffen gebunden. Wenn es aber einen echten Kernwaffentest vollzogen haben sollte (und nicht nur eine unterirdische Explosion mit chemischen oder konventionellen Sprengstoffen mit einer Detonationskraft von etwa 1.000 Tonnen), dann wäre dies ein Verstoß gegen das internationale Atomteststopp-abkommen, dem Nordkorea allerdings auch nicht beigetreten ist. In jedem Fall hat die Staatsführung über den Parlamentspräsidenten erklärt, dass weitere Atomversuche folgen würden, falls die USA "ihre feindselige Haltung und Bedrohung" gegen das Land nicht aufgeben sollten. Pjöngjang machte damit Washington für sein eigenes Atomwaffenprogramm verantwortlich. Die Begründung erscheint absurd. Doch steht hinter ihr ein rationales politisches Kalkül, das seit 1994 klar erkennbar ist und nicht auf der derzeitigen Politik der Regierung Bush beruht: Nordkorea sucht den anerkannten internationalen Status eines Kernwaffenstaates, eine amerikanische Sicherheitsgarantie (die Washington inzwischen bei Verzicht auf Kernwaffen und Einstellung des wieder aufgenommenen Atomprogramms zusammen mit modernen Leichtwasser-reaktoren für Nordkorea auch in Aussicht gestellt hat) und eine direkte bilaterale Beziehung zu den USA als Aufwertung seiner internationalen Position. Außerdem strebt es nach nuklearen Waffen als Abschreckungsmacht zur Eskalationskontrolle von regionalen Konflikten und zur Ausübung von militärischer Dominanz gegenüber dem reichen und von den USA abgeschirmten Südkorea als Kompensation der wirtschaftlichen Schwäche Nordkoreas und somit als Druckmittel gegenüber seinen Nachbarn im Süden und Osten. Auch das Feindbild Japan ist darin eingeschlossen, wie im Herbst 2006 offensichtlich wurde: Kernwaffen gegen angebliche Bedrohung nicht nur aus den USA, sondern auch aus Japan. Es handelt sich politisch um nukleare Nötigungswaffen nach allen Seiten, sogar gegenüber China und Russland, die Nordkorea bisher unterstützt und gegen amerikanischen Druck politisch abgeschirmt haben: Die beiden nahen Großmächte auf dem asiatischen Festland sollen von diesem Machtsymbol gewarnt werden, jeden Versuch zu unterlassen, Druck auf Pjöngjang auszuüben und sich mit Japan und Amerika über Korea zu verständigen. Sie sollen im Gegenteil für einen Abzug der Amerikaner aus Südkorea wirken. Dabei setzt die Diktatur in Pjöngjang offenkundig auf die eigene militärische Überlegenheit und konventionelle Angriffsfähigkeit gegen Südkorea (mit 8.000 Geschützen und 2.000 Panzern, in deren Tagesreichweite die Hauptstadt Seoul liegt), aber auch auf die Furcht vor einem neuen Krieg und vor den Folgen eines Zusammenbruchs Nordkoreas aus Schwäche, der im Krisenfall Millionen Flüchtlinge aus dem Norden über dann offene Grenzen in den Süden, nach China und nach Russland treiben könnte. Die Erpressung mit dem realen oder scheinbaren Atomwaffenprogramm wie mit dem Raketenprogramm, mit erfolglosen oder inszenierten wie mit erfolgreichen Atomwaffentests ist deshalb ein komplexes asiatisches Schattenspiel, das für alle betroffenen Länder auch ein Gedulds- und ein Geschicklichkeitsspiel ist. Nur ist die Grundregel Pjöngjangs nicht bekannt: Will Kim Jong Il wirklich Kernwaffen um jeden Preis oder ist ein Rüstungsprogramm verhandelbar?
Jedenfalls waren die Bekanntgabe des "Atomtests" Anfang Oktober und die Androhung weiterer Versuche ein dreifacher Affront gegen die UNO, deren Sicherheitsrat Nordkorea zuvor nachdrücklich vor dem Schritt über die Atomschwelle gewarnt und "ernste Konsequenzen" angedroht hatte, gegen die USA, die weiter auf die Sechser-Gespräche setzten, und insbesondere gegen China, den befreundeten und verbündeten großen Nachbarn, dem die Grenzen seines Einflusses auf Pjöngjang gewiesen wurden. Immerhin reichte dieser Einfluss aber aus, um Pjöngjang zur Rückkehr in den Sechser-Gesprächskreis zu bewegen.
Für die Nonproliferationspolitik der USA wie aller in der internationalen Kernkraftbehörde IAEA zur Überwachung des spaltbaren Materials vertretenen Staaten auf der Basis des internationalen Kernwaffensperrvertrags NPT ist die Herausforderung der internationalen Organisation zur Kontrolle der Kernenergienutzung durch Nordkorea nicht nur ein potenzielles Sicherheitsproblem, sondern auch ein aktuelles Weltordnungsproblem der dauerhaften Zuverlässigkeit internationaler Verträge über Rüstungskontrolle. Der NPT ist weiter ausgehöhlt, die Nonproliferationspolitik im Fundament geschwächt und als Instrument der internationalen Sicherheit abgewertet, wenn der Sperrvertrag weder eingehalten noch durchgesetzt wird. Nordkorea hatte den Vertrag längere Zeit vor dem Atomwaffentest gekündigt und sich so von jeder Verpflichtung frei gemacht. Auch darin lag schon eine exemplarische Provokation gegen das internationale Nonproliferationsregime.
Die Unfähigkeit der im UNO-Sicherheitsrat mit Vetorecht ausgestatteten, vom NPT in ihrer Rüstungssouveränität privilegierten Großmächte, nach 12-jähriger Krise seit 1993/94 Nordkorea von der Atomrüstung abzuschrecken oder durch eine konzertierte Diplomatie abzuhalten, stellt die Vertragsgeltung faktisch in das Ermessen aller Staaten, die zur Herstellung von Kernwaffen fähig sind. Dafür ist es nicht relevant, was Nordkorea oder irgendein anderes Land tatsächlich mit Kernwaffen anfangen könnte und welche Strategie es betreibt. Hier liegt die Parallele zum Iran: Wie der Fall Pjöngjang zeigt auch der noch nicht vollendete, noch immer mehrdeutige, wiewohl wahrscheinliche Proliferationsfall Teheran, dass es für die Nichtweiterverbreitung nuklearer Waffen letztlich auf die Vertragsdurchsetzung, d.h. notfalls auf internationale Gewaltanwendung als letztes Mittel nach Sanktionen wie Isolation durch Sperre aller Außenverbindungen, ankommt.
Eben diese Zwangsmittel wollten China und Russland nicht rechtzeitig zur Anwendung gegen Nordkorea oder den Iran kommen lassen. Damit war die internationale Sicherheits- und Ordnungspolitik in beiden kritischen Fällen blockiert. Im selben Zug waren die USA wie auch die UNO politisch ausmanövriert. Die schnelle einstimmige Verurteilung Nordkoreas durch den UNO-Sicherheitsrat am 9. Oktober nach dem über längere Zeit annoncierten Fait accompli konnte daran nichts mehr ändern. Von diesem Beschluss an hing alles Weitere davon ab, worauf sich die 15 dem Rat angehörenden Staaten ohne ein Veto einigen würden. Schon wenig später wurde aber deutlich, dass die Forderungen der USA und Japans nach harten Sanktionen wie Sperre der Verkehrsverbindungen, die einer Blockade nicht unähnlich wäre und dieselben Folgen hätte, in Peking und Moskau auf Ablehnung stießen. Die Reaktion der UNO sollte nach chinesischer und russischer Lesart "angemessen" sein und Gewalt ausschließen. Welcher Maßstab aber sollte an die Lage und an das Problem angelegt werden? Nach welchen Erfolgskriterien sollte an Nordkoreas Verhalten Maß genommen werden? Welchen Einfluss würde die Behandlung Nordkoreas auf den Iran in ähnlicher Lage mit ähnlichen Plänen und Herausforderungen der internationalen Sicherheit und der Nonproliferationspolitik haben?
Es führt auch nicht weiter, die Gründe für den Schritt Nordkoreas über die Atomwaffenschwelle in der amerikanischen Politik zu suchen, obwohl die Regierung Bush im Umgang mit Pjöngjang nicht frei von Fehlern war, v.a. weil sie bilaterale Verhandlungen mit Nordkorea, eine Forderung Pjöngjangs seit 1994, abgelehnt und auf den Verhandlungen zu sechst bestanden hatte. Aber ob ein Nachgeben in dieser Prestigefrage die Nuklearpolitik in Pjöngjang wirklich beeinflusst hätte, ist ungewiss. Beide, Nordkorea wie Iran, begannen ähnlich wie Indien und Pakistan, Libyen und Irak mit der Vorbereitung von Atomrüstungen bereits in den 1980er-Jahren und hatten die Atomrüstungsschwelle schon 1993 deutlich erkennbar erreicht, als sie begannen, den NPT zu umgehen. Damals versuchte die Regierung Clinton, Nordkorea durch das Genfer Rahmenabkommen von 1994 über die Lieferung von Leichtwasser-Atomreaktoren, Erdöl und Getreide von der Fortsetzung einer auf Kernwaffen hin orientierten Nuklearenergiepolitik abzubringen und die Kernenergieerzeugung in den sowjetrussischen Reaktoren Nordkoreas einzufrieren. Diese Politik mit offenem Ausgang, die auch von Präsident Clinton nicht zu einem gesicherten Erfolg geführt werden konnte, setzte Präsident Bush jun. nicht fort, sondern hoffte auf internationalen Druck und spielte gegenüber Pjöngjang auf Zeit. Ob seine politische Strategie im Oktober 2006 nach dem ersten, wirklichen oder nur vorgespielten, erfolgreichen oder erfolglosen, nordkoreanischen Atomwaffentest scheiterte oder nicht, blieb zunächst eine offene Frage.
Aber was immer die jeweilige Regierung in Washington vorgehabt haben könnte und welche Politik auch immer die USA im Fernen oder im Mittleren Osten betrieben: Pjöngjang und Teheran hatten unter ihren Diktaturen ihre eigenen Gründe für ihre Politik. Diese Gründe dürften auch künftig ihre Interessen bestimmen, wenn ihnen nicht mit Macht entgegengetreten wird. Dies aber würde Zwang, Gewalt zumindest durch einschneidende Sanktionen und wirksame Sperren samt den Risiken von Eskalation der Konflikte in offene militärische Konfrontationen bedeuten. China und Russland haben immer wieder Opposition gegen durchgreifende Sanktionen und natürlich gegen militärische Gewalt signalisiert, eine Opposition, der sich auch Frankreich anschließen könnte. Peking und Moskau haben kein Interesse, Washington zu einem Erfolg seiner Politik gegenüber Nordkorea oder dem Iran zu verhelfen und den USA einen internationalen Ansehensgewinn als führende Weltmacht, als Garant der internationalen Sicherheit, als Protektor des Kernwaffensperrvertrags zuwachsen zu lassen. Beide haben aber auch kein Interesse daran, dass Nordkorea zu einem für die gesamte Region Fernost gefährlichen Kernwaffenstaat wird und die USA als Schutzmacht Südkoreas und Japans in Handlungszwang setzen kann, seine Verbündeten etwa präventiv zu verteidigen. Auch deshalb drängten sie im Spätherbst 2006 auf geduldige Fortsetzung der Krisendiplomatie. Jede der drei Großmächte stand deshalb gegenüber Korea und Japan vor einem Dilemma des richtigen strategischen Handelns zur langfristigen Krisenbewältigung.
Die chinesische Aufrüstung und Wirtschaftsexpansion, die wieder entstehende russische Machtpolitik, gegründet v.a. auf die Energieausfuhr und die Abhängigkeit anderer Länder von russischem Erdgas und Erdöl, aber auch auf eine allmähliche Konsolidierung der russischen Streitkräfte mit der Modernisierung der Rüstung, haben sich fortgesetzt und stellen in der internationalen Sicherheit neue Probleme neben alte. Der Zuwachs der Einkünfte aus dem Energie-Export verspricht Russland nach internationaler Experteneinschätzung 2007 eine Devisenreserve in Höhe von etwa 300 Mrd. USD. Die Rohöl-/Erdgas-Preisentwicklung auf der Schwelle von rund 60-70 USD pro Fass Rohöl vergrößert das Ungleichgewicht in der Weltwirtschaft weiter zu Gunsten der Länder mit Energiequellen und v.a. zu Lasten der Entwicklungsländer ohne eigene natürliche Energie.
Insbesondere die rapide wachsende Nachfrage Chinas und Indiens nach fremdem Erdöl hält den Rohölpreis und damit auch den Erdgaspreis auf hohem und tendenziell mittelfristig steigendem Niveau. Davon profitieren alle Öl- und Erdgas-Exporteure, aber auch die Investoren in Kernenergie und alternativ in "sanfte" Energien, die jedoch die zunehmende Nachfrage zumindest in den nächsten zehn Jahren nur zu einem kleinen Bruchteil decken können. Diese Entwicklung hat politische Folgen: Russland gewinnt wieder an Wirtschaftswachstum, Devisen und Hebelwirkung im Weltenergiehandel für seine politischen Ziele, damit in den internationalen Beziehungen, was besonders in Europa am Fall Ukraine und am Verhältnis zu Deutschland mit dem Vorhaben Ostsee-Gasleitung unter Umgehung der baltischen und polnischen Nachbarn, in Fernost in den im September 2006 plötzlich von Moskau gestellten neuen Bedingungen für das internationale Vorhaben der Bohrungen auf Sachalin deutlich wurde: Das 2006 größte neue Erdgas-/Erdöl-Nutzungsprojekt "Sachalin II", in das bereits etwa 20 Mrd. USD ausländisches Kapital investiert worden waren, wurde zum Nachteil der ausländischen Partner, besonders Japans und der Royal Dutch Shell Company, einer von Moskau erzwungenen Revision unterzogen. Es ist in diesem Kontext interessant, dass die arabischen Erdölstaaten sich im Oktober 2006 entschlossen, die vorher zur Preisberuhigung bei hoher Nachfrage hochgefahrene Erdölförderung wieder abzusenken: Die eigenen Ressourcen sollen auf hohem Preisniveau geschont und der arabische Einfluss nicht nur auf die Welt-energieversorgung, sondern auch auf die Weltpolitik der Mächte im Sinne arabischer Ziele kostenlos aufgewertet werden. Die Erdölpolitik wird damit wieder als Mittel der politischen Strategie (wenn auch nicht unbedingt als "Erdölwaffe" wie 1973-78) eingesetzt, eine Option, die die arabischen OPEC-Länder mit Iran, Russland, Venezuela und den afrikanischen Erdölländern, auch gegenüber den USA, Europa, China und Indien, teilen. Daraus ergibt sich auch eine komplizierte Interessenmischung und instabile Gemengelage für die internationale Sicherheitspolitik in Krisen und Konflikten (Sudan mit Darfur und Kongo als afrikanische Beispiele).
Die Weltmarktpositionen derjenigen Industrieländer, die auf Erdöl oder Erdgas aus fremden Quellen angewiesen sind, werden davon belastet, Sanktionen gegen Energieausfuhrländer werden für alle Welthandelspartner zu zweischneidigen Schwertern, und damit werden Wirtschaftssanktionen als Alternative zur militärischen Krisenintervention schwierig und riskant. Dies gilt für die Politik der USA wie für die von ihren Mitgliedstaaten abhängigen Organisationen EU und UNO.
Umgekehrt wird militärische Intervention als Methode der Krisenbewältigung und der Konfliktentscheidung selbst zu einem hohen Risiko, wie die Entwicklungen nach gelungenen Feldzügen in Afghanistan und im Irak oder selbst im verhältnismäßig ruhigen Kosovo lehren. Von besonderer Bedeutung als Beispiel für nachhaltig kritische Folgen einer Intervention wie einer Gebietsräumung ist die israelische Politik in Palästina, v.a. im Gaza-Streifen. Auch hier machte weder die amerikanische noch die europäische Politik oder die der UNO im internationalen "Quartett" mit Russland einen Schritt vorwärts in Richtung konsolidierter Sicherheit als Basis für eine Wiederaufnahme der unterbrochenen Verhandlungen über einen territorialen Kompromiss und andere Friedensbedingungen.
Die Machtverteilung in der Welt ist in den vergangenen fünf Jahren deutlicher als zur letzten Jahrhundertwende wieder in Bewegung gekommen: Obwohl Amerika die führende und derzeit singuläre Weltmacht bleibt und noch für einige Zeit bleiben dürfte, sind die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit in Krisen und Konflikten, insbesondere mit militärischen Mitteln, wie die seines politischen Einflusses in den drei Brennpunkten Nahost, Golfregion und Südwestasien, auch gegenüber den unbewältigten nuklearpolitisch-strategischen Problemen der Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen, offensichtlich geworden.
Das Verhältnis der USA zu Russland ist wieder mit Spannung über Interessengegensätze und die beiderseitigen Aktionen aufgeladen. Eine schlüssige Politik gegenüber China oder mit China hat Washington (Regierung und Kongress) ebenso wenig entwickelt wie gegenüber Nordkorea, worunter auch sein Verhältnis zum von US-Truppen geschützten Südkorea leidet.
Auch die russische Politik laviert, um internationale Hindernisse zwischen den USA, China, Japan, Indien, Mittelost und Europa für eigene Vorteile zu nutzen und um außenpolitische Züge der USA zu konterkarieren. Moskaus Ziel ist dabei, bestimmenden Einfluss auf dem unmittelbaren Vorfeld an den Grenzen Russlands wiederzugewinnen und darüber hinaus eine Großmachtstellung in der Welt einzunehmen.
Dafür soll "Multipolarität" mit anderen großen Staaten als zentrales Prinzip der internationalen Staatenwelt akkreditiert werden. Aber seit Beginn der Präsidentschaft Putins ist keine weiterführende Initiative in der internationalen Politik, noch weniger eine russische "grand strategy", eine umfassende Gesamtstrategie, erkennbar geworden: Moskau handelte "von Fall zu Fall" pragmatisch und schien dabei gegenüber den von Nordkorea, Iran oder im Irak aufgeworfenen Problemen wie gegenüber der Herausforderung durch die aufstrebende asiatische Großmacht China ähnlich ratlos wie Washington. "Strategische Partnerschaften" der einen mit den anderen summierten sich in keiner Beziehung zu einer schlüssigen und nachhaltigen Interessenverbindung, in der eine strategisch angelegte, also zielstrebige gemeinsame Politik für längere Zeit entstehen könnte.
Die nordatlantische Allianz blieb offen und aktiv, auch von Europa über das Mittelmeer zum Horn von Afrika und in Afghanistan militärisch engagiert, aber mit unzureichenden Mitteln und politischen Vorbehalten ihrer Mitglieder gegen eine Ausweitung ihres Aktionsradius über die halbe Welt und somit gegen eine wirklich "globalisierte NATO", von der so viel die Rede ist. Wesentlich blieb in dieser Hinsicht das von Frankreich und Deutschland 2003/04 verursachte Scheitern des Versuchs, die NATO militärisch im Irak mit einer Sicherheitsverantwortung zu engagieren. Wäre dieser schon 2004 im NATO-Militärausschuss zu Brüssel verabredete Plan in die Tat umgesetzt worden, so hätte die NATO sich mit ihren Truppen im Irak als Besatzungsmacht neben den USA und Großbritannien wiedergefunden und wäre 2005/06 Teil des irakischen Konflikts geworden. Dies geschah 2006 nur in Afghanistan, womit die Alliierten in den sich ausweitenden Kämpfen im Süden und Osten des Landes ausreichend zu tun hatten. Für die NATO konzentrierte sich der "Krieg gegen den Terror" im fünften Jahr nach dem 11. September 2001 militärisch auf Afghanistan, politisch, nachrichtendienstlich und polizeitaktisch auf die Sicherheit vor Terroranschlägen, v.a. islamistischen, wobei dieser globale Konflikt immer deutlicher den Charakter eines mit Gewalt ausgetragenen Kulturkampfes annahm, in dem v.a. die "Dschihadisten" in der islamischen Welt die Deutungshoheit an sich rissen und den Verlauf dieses asymmetrischen Krieges mit ihren Mitteln bestimmten, während die prowestlichen Regime, v.a. die Klienten der USA im Orient, in zunehmende innere Gefährdungslagen kamen, den militanten Islam aber nicht in die Schranken wiesen oder bekämpfen konnten wie im Fall des mit Amerika offiziell verbündeten Pakistan. Die Politik des pakistanischen Präsidenten Musharraf blieb gegenüber Afghanistan wie im Innern gegenüber den Islamisten seines Landes so mehrdeutig wie die nukleare Politik und die Strategie im Gegensatz zu Indien. Er erwies sich als ebenso unverzichtbarer wie unsicherer Verbündeter im "Krieg gegen den Terror", seine eigene Position als Staatschef und Oberbefehlshaber, faktisch als Militärdiktator, so stark gegenüber den politischen Parteien wie angreifbar und abhängig von der Armee.
Trotz der in Washington deklarierten Strategie der "Präemption" und der Präventivschläge zur Beseitigung von Angriffsrisiken und direkten Bedrohungen, trotz des "proaktiv" und offensiv geführten "Krieges gegen den Terror" und obwohl in fünf Jahren seit "9/11" kein weiterer Terrorangriff auf Amerika ausgeführt wurde, wohl aber je einer in Madrid, London und Istanbul, waren 2006 die USA und ihre Verbündeten, insgesamt der Westen, politisch und strategisch gegen einen militanten, frühmittelalterlich doktrinären, aber mit modernen technischen, organisatorischen, finanziellen und medialen Mitteln operierenden Feind in die Defensive geraten.
Dies war ohne jeden Zweifel der kritische strategische Misserfolg v.a. der amerikanischen, aber auch der europäischen und insgesamt der westlichen Politik. Er bestätigt die Erfahrung, dass Guerilla und Terror mit konventionellen Streitkräften allein nicht beizukommen ist und dass auch "proaktive" Terrorbekämpfung mit überwiegend militärischen Mitteln nicht zum Erfolg führen kann. Für das damit verbundene politische Dilemma steht aber nirgendwo, weder in Amerika noch in Europa oder im Orient selber, eine Lösung in Aussicht.
Irak am Rande des Bürgerkriegs: Chaos, Anarchie und Terrorherrschaft
Im Jahr 2006 bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen über die längerfristigen Folgen des amerikanisch-britischen Interventionskrieges, der im Frühjahr 2003 die irakische Armee in einem Blitzfeldzug überwältigt und das diktatorische Polizeistaat-Regime Saddam Husseins gestürzt hatte. Die seit dem Sommer 2003 ununterbrochen, wenngleich nicht gleichmäßig, sondern in Wellen eskalierende Krise der amerikanischen Besatzungspolitik mit militärischen Operationen gegen einen kaum fassbaren Feind erreichte im Jahre 2006 einen neuen Höhepunkt und erfasste den gesamten Irak inklusive des eben mit Verspätung begonnenen Staatsneubaus. Die ersten halbwegs freien Wahlen im Irak seit der Revolution von 1958 und nach drei Jahrzehnten polizeistaatlicher Diktatur der Baath-Partei unter Saddam Hussein hatten zwar die neue Verfassung und die aus ihnen hervorgegangene Regierung demokratisch legitimiert. Auch war die Wahlbeteiligung unter der Terrordrohung und bei den Verkehrsbehinderungen relativ hoch. Sie konnten deshalb trotz der massiven Wahlverweigerung der Sunniten als Vertrauensvotum in die entstehende neue Ordnung gewertet werden. Doch die aus den Wahlen hervorgegangene Regierung, ein Kompromiss zwischen den Hauptparteien der Schiiten, Kurden und Sunniten, wurde weiter heftig von den Extremen her bekämpft, fand zwar Zustimmung in der breiten Bevölkerung, aber wenig aktive Unterstützung und konnte sich politisch nicht durchsetzen. Ihre Autorität war von Anfang an schwach und umstritten, verbrauchte sich schnell unter dem Druck der Gegensätze zwischen den Koalitionspartnern in der allgemeinen Unsicherheit, die sich im Laufe des Jahres 2006 wie zuvor schon 2005 und 2004 rasch ausbreitete und die Ansätze von Ordnung, Versorgung der Bevölkerung und wirtschaftlichem Wiederaufbau stets aufs Neue einriss. Die chaotischen Zustände und die grassierende Anarchie, verbunden mit zunehmender Gewaltkriminalität und Ausbreitung des Terrors, bewahrheiten die schon im Frühjahr 2003 nach dem Ende des Feldzugs vom damaligen Vizeverteidigungsminister der USA, Paul Wolfowitz, dem späteren Weltbankpräsidenten, in Bagdad aufgestellte These "Sicherheit ist gleich Elektrizität". Aber die eine ist ohne die andere nicht zu haben.
Weder die fremden Stationierungstruppen, die als Besatzungsmächte wahrgenommen wurden, noch die irakischen Sicherheitskräfte erzielten durchschlagende Erfolge gegen den Untergrund und die Terroristen. Die Extremisten unter den Sunniten und Schiiten konnten trotz einiger taktischer Erfolge der Regierungstruppen und der "Koalitionstruppen" den religiösen Bürgerkrieg anfachen, der v.a. die eigene Bevölkerung trifft und den Zerfall des neuen Staates beschleunigt. Die USA und ihre weniger werdenden Verbündeten in der "Koalition" bleiben zwar jederzeit zu Eingriffen und zu groß angelegten militärischen Operationen fähig. Doch ihre Aktionen im Raum Bagdad, im "sunnitischen Dreieck" westlich der Hauptstadt und im Zentralirak stießen bisher unverändert nach einigen erbitterten Gefechten schließlich meist ins Leere. Der Feind wich jedes Mal am Ende aus und sammelte sich wenig später neu an anderer Stelle, um sich neu zu stellen, meist in Hinterhalten oder für harten Widerstand auf Zeit in einem Ort wie Falludscha, Ramadi, Bakuba, Samarra, Tikrit im Nordwesten Bagdads oder in Nadschaf im schiitischen Teil des mittleren Irak. Im Sommer räumte der Alliierte und US-Oberkommandierende im Irak, General Casey, öffentlich ein, dass die amerikanisch-irakische Offensive im Raume Bagdad gescheitert war: Der Untergrund konnte nicht ausgehoben, der Widerstand nicht gebrochen werden. Kurze Zeit zuvor hatten General Casey und der Oberbefehlshaber des für den Mittleren Osten verantwortlichen US-Zentralkommandos, General Abizaid, vor der "Gefahr eines Bürgerkriegs" gewarnt. Bis dahin war US-amtlich immer nur von "sektiererischer Gewalt" die Rede gewesen. 141.000 US-Soldaten im Irak, davon 120.000 der U.S. Army in 15 Kampfbrigaden laut Mitteilung des Generalstabschefs des Heeres General Peter Schoomaker zum letzten Quartalsbeginn 2006 (eine Präsenzstärke, die bis 2010 erhalten werden soll), plus weitere 15.000 alliierte Soldaten und die neue irakische Armee samt Polizeitruppen waren noch immer nicht in der Lage, Sicherheit zu gewährleisten und den wirtschaftlichen Aufbau abzuschirmen. Schließlich setzten die Generäle der Regierung in Bagdad eine Frist von 12-18 Monaten für die Übernahme der Verantwortung für die Sicherheit des Landes.
Taktisch drehten sich die militärischen Operationen im Kreise wie die politischen Manöver in Bagdad. Strategisch hatte sich das Unternehmen "Irakische Freiheit" festgefahren. Politisch war die Position der USA als externe Vormacht am Golf erschüttert wie die pro-westlichen Regime, während die US-Streitkräfte samt deren einsatzfähigen Reserven an den Irak gebunden waren. Der US-Verteidigungsminister hatte erwartet, die US-Truppen bis Ende 2006 auf 100.000 Soldaten zu reduzieren, also minus 40.000. Doch dieses Ziel musste angesichts der kritischen Lageveränderung im Irak aufgegeben werden. Nach General Schoomakers Bilanz verloren die US-Truppen im Irak von März 2003 bis Ende September 2006 insgesamt 2.750 Soldaten. Diese Verluste sind bei einer durchschnittlichen Dauerpräsenzstärke um die 150.000 zwar weniger als 2% in 43 Monaten und reichen deshalb nicht einmal entfernt an die Verlustraten im Vietnamkrieg heran, sondern bleiben in einer weitaus geringeren Größenordnung. Doch begannen sie psychologisch auf der Kriegführung zu lasten. Aber die finanziellen Kriegsaufwendungen sind seit dem Ende des Feldzugs im April 2003 von Jahr zu Jahr angestiegen. Für das Etatjahr von Oktober 2006 bis Oktober 2007 verlangte die Heeresführung mit 138,8 Mrd. USD fast 40 Mrd. über die bisher geplanten Ausgaben hinaus.(Fußnote 1/FN1) Für eine Sicherheitspräsenz ist der Aufwand im Irak exorbitant und wiegt immer schwerer auf dem US-Militärbudget. Entscheidend aber ist die negative Entwicklung der Sicherheitslage mit etwa 100-120 irakischen Todesopfern am Tage seit dem zweiten Quartal 2006. Der "Ehrenpakt gegen Gewalt", den der Ministerpräsident al-Maliki im Sommer mit 600 irakischen Stammesführern schloss, um die blutige Anarchie mit politischem Einfluss einzudämmen und die Lage zu wenden, hatte im Herbst noch immer keinen Erfolg gezeitigt.
Die USA hatten sowohl die strategische Flexibilität als auch die Initiative verloren. Militärische Überlegenheit nach technischen und operativen Maßstäben konnte nicht mehr in planvolles zielgerichtetes, also strategisches Handeln zum Erfolg über den Feind und für den Freund umgesetzt werden. Damit drohte der amerikanischen Machtpolitik nicht nur am Golf, sondern im gesamten Orient die Lähmung. Präsident Bushs beschwörende Worte zum 5. Jahrestag des Terrorangriffs vom 11. September 2001, "die Sicherheit Amerikas" liege "auf den Straßen von Bagdad" und der "Krieg gegen den Terror" würde nur von einem Sieg, "entweder Amerikas oder der Extremisten" beendet werden, klangen wie ein letzter Durchhalteappell. Die These des Präsidenten, der Krieg von 2003 gegen Saddam Hussein habe "Amerika sicherer gemacht", war als strategische Lagebeurteilung nicht mehr zu halten, denn die Tatsachen im Irak und im Orient von Iran bis nach Pakistan und Korea widersprachen ihr ebenso wie die von ihnen begründete Perspektive einer global wirkenden Unsicherheit, die in den dreieinhalb Jahren seit dem militärischen Eingriff im Irak unbestreitbar größer geworden ist.
Kritische Lage in Afghanistan und ein unzureichendes militärisches Engagement der NATO
Das Jahr 2006 am Hindukusch, wo die Sicherheit Europas wie Amerikas in einer weit ausgreifenden Vorwärtsverteidigung abgeschirmt und wo die Hauptoperationsbasis des islamistischen Terrorismus beseitigt werden soll, war keine gute Zeit für den Westen noch für Afghanistan selber. Seit dem späten Frühjahr 2002, als die USA einen Großteil ihrer Truppen aus dem Land an den Golf abzogen, um auf den Irak schlagen zu können, in dem die Regierung Bush inzwischen "die zentrale Front im Krieg gegen den Terror" sah, hatten die bis Ende 2001 über die Grenze nach Pakistan abgedrängten Taliban-Milizen und der harte Kern der Al Qaida sich wieder erholt. Im Jahre 2005 zeigte sich ihre Aggressivität in der zunehmenden Zahl und Dauer ihrer Überfälle. Schon im Sommer 2005 wurde die Lage in weiten Teilen Afghanistans, v.a. im Süden und im Osten bei der NATO als "instabil" eingeschätzt. Der damalige deutsche Verteidigungsminister Peter Struck urteilte, dass die deutschen Truppen in der von der NATO geführten ISAF wahrscheinlich noch "zehn Jahre" in Afghanistan bleiben müssten, um die gefährdete Sicherheit zu schützen. Ein Jahr später wagte niemand mehr in Berlin oder Brüssel, in London oder Paris, in Rom, Madrid oder Den Haag sich auf eine Frist festzulegen. Alle größeren europäischen Truppensteller der NATO für Afghanistan richteten sich 2006 auf längere Präsenz und Rotation ihrer Verbände ohne Aussicht auf eine Ablösung, aber v.a. auch auf wachsende Risiken für ihre Truppen, auf zunehmende Verluste in häufigeren Gefechten und auf härtere Kämpfe gegen einen erstarkten und besser bewaffneten Feind ein. Tatsächlich begann 2006 im Süden und Osten Afghanistans der Partisanenkrieg in größerem Maßstab. Es wurde klar, dass die Taliban, aber auch andere islamistische Gruppen und verschiedene paschtunische Clanführer, die sich der ohnehin schwachen Autorität der Regierung des Präsidenten Karsai in Kabul nicht unterordnen oder ihre eigenen Geschäfte mit Mohnanbau und Opiumgewinnung ungestört fortsetzen wollen, versuchten, die neue Staatsgewalt und deren ausländischen Rückhalt in Gestalt der fremden Truppen, Aufbauhelfer und internationalen Organisationen aus dem Lande zurückzudrängen. Wie die Regierung in Bagdad war auch jene in Kabul vom Lande isoliert und für ihre Existenz auf die fremden Truppen angewiesen. Ohne US-/ISAF-Eskorten und Transportmittel, ohne Abstützung für die Etappen auf deren Basen konnte auch Präsident Karsai nicht weit im eigenen Lande reisen. Selbst die Hauptstadt war nicht sicher. Zahlreiche Terroranschläge trafen Polizeiposten, Militärstreifen und den Straßenverkehr. An den Landstraßen nahmen die Überfälle und Sprengfallen gegen vorbeifahrende Konvois und Patrouillen zu. Nur der Norden und Westen des Landes blieben noch relativ ruhig. Aber im Süden, in den alten Taliban-Hochburgen, kehrten die islamistischen Milizen in Bataillonsstärke zurück, um in ganzen Ortschaften die Gewalt zu übernehmen, Schulen und Krankenstationen zu zerstören und das internationale Aufbauwerk wieder zunichte zu machen. Die Rückkehr der Islamisten mit solcher Kampfkraft überraschte die alliierten Truppen der ISAF, die ihrerseits mit örtlichen Gegenangriffen konterten und die Initiative zurückzugewinnen suchten. Briten, Kanadier und Niederländer, die von den Amerikanern den Süden mit seinen fünf unruhigen Provinzen übernommen hatten, fügten den Taliban schwere Verluste zu, konnten aber das Eindringen neuer Kämpfer aus dem paschtunischen Grenzgebiet Pakistans nicht verhindern und sahen sich demselben unveränderten Problem gegenüber, das schon die Amerikaner nicht hatten meistern können: Die NATO-Truppenstärke in der ISAF reichte nicht aus, um das Land militärisch unter Kontrolle zu bringen und zu halten. Die Intensivierung der Kämpfe im Süden und Osten, wo die Amerikaner operieren, brachte den alliierten Befehlshaber, den britischen General Richards, schon im Februar 2005 zu einer Truppennachforderung von 1.000 Soldaten, die aber über 18 Monate bis zum Herbst 2006 von Brüssel nicht erfüllt wurde, weil die Bündnispartner zögerten, mehr Soldaten, mehr Hubschrauber (um die NATO-Generalsekretär de Hoop Scheffer seit zwei Jahren geworben hatte) und Waffen nach Afghanistan zu entsenden. Der NATO-Oberkommandierende in Europa, der amerikanische General Jones, bezifferte das Manko an einsatzfähigen NATO-Truppen in Afghanistan im September 2006 auf etwa 15% der Gesamtstärke von rund 32.000, davon 12.000 Amerikaner, die nun unter alliierten Befehl traten. Weitere 10.000 US-Soldaten kämpften außerhalb von NATO und ISAF in ihrem Unternehmen "Nachhaltige Freiheit", nunmehr auf das Grenzgebiet zu Pakistan im Osten konzentriert, gegen den Untergrund der Al Qaida oder bildeten die afghanische Armee aus.
In dieser Situation übernahm im Herbst 2006 die NATO als ISAF-Leitorganisation die militärische Verantwortung für das ganze Land. Großbritannien, Kanada, Polen und Rumänien versprachen zusätzliche Soldaten für Afghanistan. Frankreich, die Türkei, Deutschland, Italien und Spanien lehnten Verstärkungen ihrer ISAF-Kontingente zunächst ab - die Frage nach gesteigerter Allianzsolidarität dieser Verbündeten im "Krieg gegen den Terror" blieb in Afghanistan weiter offen. Dies gilt auch für die Bekämpfung der Rauschgiftproduktion durch die ISAF, zu der die UNO die NATO dringend aufforderte. Afghanistan liefert im neuen Jahresdurchschnitt seit 2005 laut UNO rund 90% des Opiums für die weltweite Heroinherstellung, eine Steigerung um 10% seit 2003/04.
Ähnlich wie im Irak dreht sich auch in Afghanistan die destruktive Spirale des Circulus vitiosus einer ins Leere laufenden Strategie. Nur dreht sich der Kreisel noch auf einem niedrigeren Niveau der Gewalt und langsamer. Noch ist nichts entschieden. Viel wird für die NATO davon abhängen, ob es ihr gelingt, einen sinnvollen Modus Vivendi, ein pragmatisches Arrangement mit den Stammesfürsten und Clanführern nicht nur im Norden und Westen, sondern auch im Süden und Osten zu finden; dieses würde allerdings auch eine Verständigung über eine Begrenzung des Mohnanbaus und der Drogenherstellung einschließen müssen, von denen die Taliban seit ihrem Sturz von der Macht ebenfalls profitieren, um ihre Kriegskasse zu füllen, deren Ertrag aber v.a. die Kassen der Warlords und der Stammesführer, die zugleich die Provinzfürsten sind, füllt. Hier liegt im Widerspruch der Notwendigkeiten das Dilemma zwischen dem übergeordneten politischen Zweck der internationalen Präsenz und den Erfolgsbedingungen. Wenn aber die Ziele nicht erreicht werden könnten, was sollte dann die Anstrengung? Die Antwort legt das tiefere Dilemma in Afghanistan bloß: Ohne die ISAF mit der NATO und den US-Truppen würde der neue Staat zusammenbrechen. Also bietet sich eine "exit strategy" der Beendigung der internationalen Militärpräsenz und des Kampfes im Unternehmen "Nachhaltige Freiheit" auch nach fünf Jahren noch nicht an. Im Gegenteil: Die Ausdehnung der NATO-Verantwortung für die Sicherheit auf ganz Afghanistan treibt das militärische Engagement der Verbündeten immer weiter und immer tiefer in ein Land, das niemals geeint oder befriedet war und das im Westen wie im Osten zwischen Nachbarn liegt, die von außen beherrschenden Einfluss gewinnen wollen: Iran und Pakistan. Im Norden ist die Lage ruhiger, aber auch dort liegen jenseits der Grenzen Staaten in Zentralasien, die Stammesverbindungen und damit politische Einflussmittel in Afghanistan haben, und China ist nicht fern. Die gesamte geopolitisch-strategische Konstellation eignet sich ebenso wenig für eine langjährige NATO-Präsenz wie US-Präsenz.
Palästina und der Libanonkrieg
Die katastrophale Lage im Palästinensergebiet von Gaza, die Kalamitäten im Westuferland des Jordan, wo Palästina mit dem Annex Gaza als unabhängiger Staat entstehen soll, der gewalttätige Streit zwischen den rivalisierenden radikalen Organisationen Fatah und Hamas um die Macht seit den Wahlen hängen mit der Entwicklung im Libanon hin zum Hisbollah-Krieg Israels zusammen. Dieser Konnex ist nicht augenfällig, aber das Bindeglied in Damaskus verdeutlicht ihn in der syrischen Konfliktstrategie gegen Israel für eine Zweifrontenkriegslage indirekter Aggression ohne militärische Beteiligung Syriens mit dem Ziel, den von Israel annektierten Golan zurückzugewinnen. Für einen Krieg gegen Israel hat Syrien seit den verlorenen arabischen Koalitionskriegen von 1967 und 1973 nach dem Ausscheiden Ägyptens aus der arabischen Front keine Verbündeten mehr. So bleibt nach den Separatfriedensschlüssen Ägyptens und zwanzig Jahre später Jordaniens mit Israel Syrien nur eine Option, denn zu einem Krieg im Alleingang ist es nicht fähig: Israel an dessen Grenzen im Norden und im Süden durch andere zu bedrohen oder jedenfalls zu stören, ohne selber die Risiken einer militärischen Konfrontation auf sich zu nehmen. Die syrisch-israelische Grenze ist seit 1973 ruhig geblieben, dafür lodert der Konflikt im Libanon durch Grenzverletzungen aller Art und in Palästina durch Guerilla, Terroranschläge und gewalttätige Provokationen in unregelmäßigen Abständen auf. Für Damaskus sollen diese dem Zweck dienen, Israel im Besitz arabischer Gebiete nicht zur Ruhe kommen zu lassen, den seit 1948 bestehenden Kriegszustand mit Israel aufrechtzuerhalten und sozusagen "mit Leben zu erfüllen" - dem Leben und den Opfern der arabischen Grenzbevölkerungen in zwei Ländern, über die Damaskus bisher (wie früher auch über Jordanien) ein "droit de regard", eine Aufsicht und Mitentscheidung über deren Regierungen und Politik, beansprucht hat. Im Libanon war diese syrische Vormachtstellung seit dem Bürgerkrieg der 1970er/80er-Jahre sogar als eine die libanesische Souveränität faktisch beschränkende Oberherrschaft mit syrischen Truppen und Sicherheitsdiensten verfestigt.
Erst auf internationalen Druck hin wurde sie vor zwei Jahren mit dem syrischen Rückzug beendet, nachdem Damaskus mit der Ermordung des ehemaligen libanesischen Regierungschefs Rafik Hariri kompromittiert worden war. Aber seither versucht Syrien indirekt mit Hilfe der schiitischen Hisbollah und dem Rückhalt des Iran für gemeinsame Ziele wieder einen dominanten Einfluss im Libanon zu gewinnen, was Damaskus eine letzte politische Konfliktoption gegen Israel erhalten würde.
Wie immer diese Partie weitergespielt wird und ausgehen mag, sie wird im Libanon und in Palästina nicht einfach als Stellvertreterauftrag fortgesetzt, sondern im jeweils eigenen Interesse. Dabei wirken die Ereignisse und politischen Konstellationen in beiden Grenzländern Israels aufeinander. Das Beispiel des israelischen Rückzugs aus dem besetzten Südlibanon im Frühjahr 2000, das die Hisbollah als ihren Sieg feierte, verführte die radikalen Palästinenser zu der Annahme, sie könnten durch bewaffneten Widerstand gegen die israelische Besatzung und durch Angriffe auf jüdische Siedlungen, schließlich durch Terroranschläge gegen Israel selbst, den Abzug der israelischen Armee aus Gaza und aus dem Westjordanland erzwingen oder zumindest in den Verhandlungen mit Israel unter amerikanischer Vermittlung eine Position der Stärke zur Durchsetzung ihrer Maximalforderungen gewinnen. Daran scheiterten im Jahre 2000 die Diplomatie der USA unter Präsident Clinton und die israelische Regierung des Premierministers Barak. Der Wahlsieg Scharons Anfang 2001 war die Folge und dessen Konsequenz die Verhärtung der Fronten mit einer Eskalation der Gewalt auf beiden Seiten bis zur einseitigen Räumung des Gazastreifens durch Israel. Diese wiederum nährte die arabische Illusion, Israel könnte zur Aufgabe der besetzten Gebiete mit Gewalt gezwungen werden.
Die beiden islamistischen Parteien Hamas und Hisbollah mit ihren politischen Hochburgen und bewaffneten Milizen in Gaza bzw. im Südlibanon wurden von Damaskus und von Teheran schon seit dem Sturz Saddam Husseins im Irak nach dem Krieg von 2003 zu neuen Aktionen gegen Israel ermutigt: Syrien und Iran wollten die frei gewordene Beschützerstellung des Irak einnehmen. Wie die Kausalkette der Ereignisse und Einflüsse seither, besonders im Jahre 2006 vor den beiden Soldatenentführungen nach Überfällen auf israelische Grenzposten, die den Anlass zur Eskalation gaben, geschlossen war, ist noch nicht erkennbar. Fehlkalkulationen über Israels vermutliche Reaktionen waren offensichtlich mit im Spiel.
Das Resultat, der Libanonkrieg im Norden und eine verstärkte Repression im Süden, hat die arabischen Nachbarn Israels ihren Zielen nicht näher gebracht, sie aber in den Mittelpunkt der nahöstlichen Bühne gerückt, wo v.a. die Hisbollah ihren angedichteten Kriegsruhm und ihren "göttlichen, historischen und strategischen Sieg", wie ihr Führer Nasrallah den relativen Erfolg im Krieg als Überlebende genannt hat, auskostet. Israel hat dabei Selbstvertrauen und Ansehen verloren, auch internationale Unterstützung im kritischen Moment des Krieges, als der israelische Feldzug nicht vorankam. Auch ist die Lage im Nahen Osten insofern zum Nachteil Israels verändert, als seine Armee ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit und der Überlegenheit bis zur Dominanz über jeden Feind mit der Fähigkeit, jedes gesteckte Ziel zu erreichen, eingebüßt hat. Allein die Tatsache, dass die Armee den Norden Israels bis nach Haifa nicht gegen Kurzstreckenraketen abschirmen konnte, dass einen ganzen Monat solche Raketen in Nordisrael niedergingen und Hunderttausende Israelis sich in den Süden in Sicherheit bringen mussten, dass die Wirtschaft beeinträchtigt und die Kriegskasse ohne eine klare militärische Entscheidung geleert wurde, bezeichnet einen empfindlichen Misserfolg und einen Verlust an Sicherheit im Krieg, also einen strategisch-politischen Rückschlag.
Doch ein Blick auf den Libanon und auf Gaza nach dem Sommerkrieg um Israel zeigt auch, dass es auf der arabischen Gegenseite gleichfalls keine Sieger in diesem Krieg gab: Hisbollah bleibt zwar, zumindest vorderhand, die einzige präsente und potente politische Kraft im armen schiitischen Südlibanon. Auch hat sie wahrscheinlich einen Großteil ihrer Waffen, v.a. ihres Kurzstreckenraketenarsenals, von dem sie nur etwa 4.000 von rund 20.000 verfeuerte, noch immer in Besitz. Eine künftige Ergänzung durch Nachschub aus Syrien und aus dem Iran bleibt unter günstigen Umständen möglich. Ihre Entwaffnung, vom UNO-Sicherheitsrat gefordert, wird äußerst schwierig werden, wenn sie überhaupt gelingt. Diese undankbare Aufgabe ist der libanesischen Armee zugefallen und dürfte deren Zusammenhalt erheblich strapazieren, wenn sie tatsächlich in Angriff genommen werden sollte. Aber die Hisbollah hat auch den Großteil ihrer grenznahen Stellungen verloren, dazu die Bewegungsfreiheit für ihre schweren Waffen und ihre Miliz-Kampfverbände. Schließlich hat sie die militärische Kontrolle über den Südlibanon verloren, denn die UNIFIL-Schutztruppe wurde erheblich verstärkt mit europäischen Truppen moderner Ausrüstung, und nach 38 Jahren ist die reguläre libanesische Armee in einer Truppenstärke von bis zu 15.000 Soldaten zurück im Süden. Israels Armee aber steht weiter, ungeschwächt, jenseits der Grenze, und die Lektionen dieses Krieges werden in Israel gelernt werden.
Im Libanon wird sich die Hisbollah früher oder später, wenn der Rauch des Krieges sich verzogen hat und die Emotionen der Bevölkerung wieder abgeklungen sind, der Frage stellen müssen, was sie eigentlich in diesem Krieg für den Libanon erreicht hat. Sie wird auch Objekt gegnerischer Koalitionen in der libanesischen Politik wie nie zuvor werden, denn nicht nur die Christen und die Drusen, sondern auch gemäßigte Schiiten, die während des Krieges Solidarität mit der kämpfenden Hisbollah demonstrierten oder zeigen mussten, haben drei objektiv gestellte Fragen: Will die Hisbollah regieren? Will sie weiter mit Syrien verbündet und das Werkzeug der Regierung in Damaskus gegen die Unabhängigkeit Libanons sein? Will sie den Kriegszustand mit Israel erhalten und neue Kriege riskieren, die sie ebenso wenig für Libanon gewinnen kann wie den von 2006?
Israel unterlag keineswegs in einem "asymmetrischen Krieg" einem schwächeren Gegner. Seine Armee machte Fehler, die politische Strategie, soweit die Regierung eine solche hatte, stimmte nicht mit der militärischen überein: Israel verbrauchte die knappe Zeit, die es international zur Verfügung hatte, mit einer zögerlichen Kriegführung bei zu geringem Kräfteansatz. So war ein durchschlagender Erfolg nicht möglich. Der Waffenstillstand konnte nicht mehr verzögert werden, und so musste man sich mit einem halben Erfolg zufrieden geben.
Aber Israel führte auch einen indirekten Demonstrationskrieg gegen Syrien, den Iran und jedes andere Land der Region, das künftig Kriegspläne gegen Israel haben könnte: In Damaskus saß man in der ersten Loge bei der Betrachtung dieses Krieges und seiner Folgen für den Kriegsschauplatz Libanon. Dort wie in Teheran kann man die Wirkung der israelischen Luftangriffe und Artillerie ermessen, zumal weder Syrien noch Iran eine Luftabwehr haben, die eine Luftmacht wie Israel wirksam behindern könnte. Die weiteren Konsequenzen dieser Machtdemonstration der Zerstörungskraft und damit die weitere strategische Dimension dieses Libanonkrieges 2006 sind noch nicht erkennbar, womöglich noch nicht entstanden. Aber der von vielen befürchtete "Flächenbrand" trat nicht ein, eine horizontale Eskalation des Krieges fand nicht statt, auch weil der Irak Saddam Husseins nicht mehr existiert. Syrien ist international derzeit isoliert, hat aber die Chance zu einer Verhandlungspolitik mit Israel, das seinerseits diplomatische Optionen der Konfliktregelung wieder höher einschätzen muss als zuvor. Dennoch ist für Israel die Abschreckung, einschließlich der nuklearen, deutlich als die unverzichtbare Voraussetzung seiner Sicherheit hervorgetreten, gerade weil sie gegenüber der Hisbollah versagte. Damit ist die Existenzfrage gestellt: In Israel werden die militärische Überlegenheit und die Zuverlässigkeit der Abschreckung gegenüber jedem potenziellen Angreifer das Sicherheitskriterium sein. Dies macht die iranische Atompolitik zum größten Risikofaktor nicht nur in der Region, sondern auch für die globale Sicherheit und besonders für die Europas als Nachbarregion im Westen. Hier liegt die strategisch-sicherheitspolitische Herausforderung der EU wie der NATO und der USA.
Für Amerika als führende Weltmacht, als externe Vormacht im Mittleren Osten und im Fernen Osten, als Führer der westlichen Bündnisse, allen voran der nordatlantischen Allianz, und als bisher einzigem potenten Garanten des internationalen nuklearpolitischen Sicherheitsregimes sind die in den Brennpunkten der Problemfelder entstandenen oder verschärften Krisen mit einer kritischen weltpolitischen und globalstrategischen Entwicklung verbunden. Die amerikanische Regierung hat dieser Entwicklung bisher keine kohärente Strategie entgegenzusetzen vermocht. Der "Krieg gegen den Terror" ist weiter weder gewonnen noch verloren. Die übrigen Mächte spielen bisher nur Nebenrollen und suchen ihre eigenen Interessen zu fördern. Weder UNO noch EU, weder NATO noch irgendeine andere internationale Organisation oder Staatengruppierung hat sich in dieser globalen Konstellation mit Erfolg als "global player", geschweige denn als wirksamer strategischer Akteur erwiesen.
ANMERKUNG:
(Fußnote 1/FN1) International Herald Tribune, 12.10.2006, S.5.
Prof. Dr. Lothar Rühl
Staatssekretär a.D. (ehemals im Bundesverteidigungsministerium, Bonn); Professor für Internationale Beziehungen am Forschungsinstitut für Politische Wissenschaft und Europäische Fragen der Universität zu Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät; Mitglied akademischer Beirat des Nato Defence College Rom.
Ihre Meinung/your opinion/votre opinion: