Die „Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten”, kurz Haager Konvention 1954, wurde am 14. Mai 1954 auf einer Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) angenommen. Diese bedeutende Konvention wurde durch die beiden Zusatzprotokolle der Jahre 1954 und 1999 ergänzt und bildet die heutige Grundlage der militärischen und völkerrechtlichen Verpflichtung zum Kulturgüterschutz.
Die Konvention umfasst die Sicherung und Respektierung von Kulturgut in bewaffneten Konflikten und damit einhergehende zivile und militärische Maßnahmen in Friedenszeiten. Sie formuliert das Verbot, Kulturgüter während eines bewaffneten Konflikts zu beschlagnahmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Darüber hinaus wird festgelegt, dass bereits in Friedenszeiten Vorbereitungen zum Schutz von Kulturgütern zu treffen sind. Von besonderer Bedeutung ist die Verankerung der Möglichkeit einer strafrechtlichen Verfolgung von Einzelpersonen bei Verletzung der Konventionsbestimmungen sowie jenen Personen, die den Befehl hierzu erteilen.
Haager Konvention 1954, Artikel 3 – Sicherung des Kulturguts:
„Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, schon in Friedenszeiten die Sicherung des auf ihrem Gebiet befindlichen Kulturguts gegen die absehbaren Folgen eines bewaffneten Konfliktes vorzubereiten, indem sie alle Maßnahmen treffen, die sie für geeignet erachten.”
Haager Konvention 1954, Artikel 4 – Respektierung des Kulturguts:
Kulturgut wird gemäß Haager Konvention 1954 in Artikel 1 wie folgt definiert:
Eine weitere Definition, die sich auf bewegliches Kulturgut bezieht, ist in Artikel 1 des „übereinkommens über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und übereignung von Kulturgut” aus 1970 angeführt. Hierbei gilt „als Kulturgut das von jedem Staat aus religiösen oder weltlichen Gründen als für Archäologie, Vorgeschichte, Geschichte, Literatur, Kunst oder Wissenschaft besonders wichtig bezeichnete Gut”, das in zwölf Unterkategorien aufgeschlüsselt wird.
136 Staaten haben die Haager Konvention 1954 unterzeichnet.

Das Kennzeichen für Kulturgut gemäß Haager Konvention 1954 besteht aus einem Schild in Blau und Weiß. Die Republik Österreich hat die Haager-Konvention im Jahr 1964 ratifiziert (BGBl. Nr. 58/1964). In Erfüllung dieser Konvention wurde 1976 die Erfassung und Evidenzhaltung der Kulturgüter begonnen.
Die Zusatzprotokolle der Haager Konvention der Jahre 1954 und 1999 erweitern den Schutz für Kulturgüter in bewaffneten Konflikten.
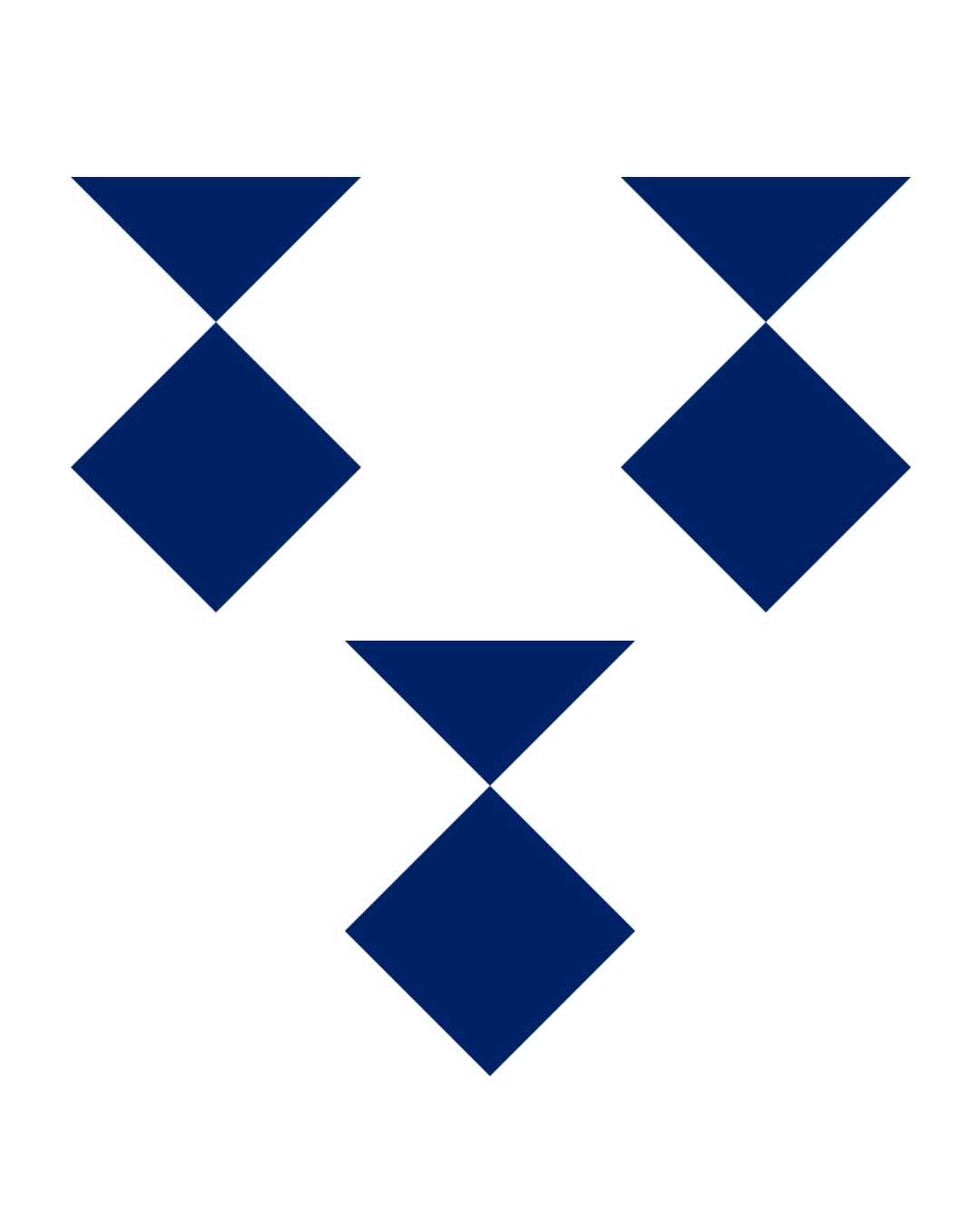
Der Sonderschutz für Kulturgut wird im Ersten Protokoll der Haager Konvention von 1954 definiert. Kulturgüter unter besonderem Schutz werden mit dem blau-weißen Kennzeichen für Kulturgut in dreifacher Ausgabe gekennzeichnet. Zentren, in denen sich Denkmäler und andere unbewegliche Kulturgüter von großer Bedeutung befinden, oder auch Kulturgüter, die transportiert werden, können unter besonderen Schutz gestellt und ebenfalls durch dieses Symbol gekennzeichnet werden.

Der Sonderschutz wurde durch den verstärkten Schutz des Zweiten Protokolls, das 1999 verabschiedet wurde, ergänzt. Dieses Protokoll erweitert und verstärkt den Schutz für besonders bedeutende Kulturgüter, die in ein internationales Register eingetragen werden. Damit wird ein verstärkter Schutzmechanismus geschaffen, der die Bewahrung einer begrenzten Anzahl von Kulturstätten in Zeiten bewaffneter Konflikte sichern soll. Obwohl das Protokoll den Vertragsstaaten nicht vorschreibt, ihre im Register eingetragenen Kulturgüter mit einem besonderen Emblem zu kennzeichnen, wird es in den Leitlinien für die Durchführung des Zweiten Protokolls empfohlen. Damit soll die Erkennbarkeit und Identifizierung von Kulturgütern unter verstärktem Schutz insbesondere während Kriegshandlungen gewährleistet und die Wirksamkeit des Zweiten Protokolls sichergestellt werden. Kulturgüter unter verstärktem Schutz werden mit einem Erkennungszeichen in Blau-Weiß mit roter Umrandung gekennzeichnet.
Siehe: The Blue Shield Emblem: Guidance for Use – Blue Shield International